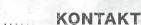independent online music | info@sellfish.de
Rilo Kiley - Live
Schocken / Stuttgart
„This is our last show, let’s make it a good one“
18.07.2005
Ungewöhnlich voll ist es Montag Abend im Schocken, und obwohl ich erst kurz nach offiziellem Beginn den Club betrete, steht da schon jemand auf der Bühne. Entgegen schlägt mir zuerst die unglaublich schwüle Luft, dann höre ich die sanften Klänge von Rilo-Kiley-Gitarrist Mike Bloom. Ruhiger Songwriter-Pop ist das, nichts Spektakuläres, aber Bloom hat eine gute Stimme. Leider geht das Ganze in der allgemeinen Unruhe des Publikums etwas unter. In den Gesprächsfetzen, die um mich herumschwirren, kommt extrem häufig der Name Jenny Lewis vor. Die Rilo-Kiley-Sängerin sorgt schon im voraus für Gesprächsstoff und ist sicher einer der Gründe, warum das Schocken so voll ist. Der Bright-Eyes-Support im Frühjahr sowie eine Veröffentlichung auf Saddle Creek haben sicher auch seinen Teil dazu beigetragen, im Publikum könnte man ohne weiteres einen Conor-Oberst-Lookalike Contest ausrufen. Egal, wer so gute CDs herausbringt, hat sich ein großes Publikum verdient, und die Livequalitäten rechtfertigen sowieso alles, wie man später sehen wird.
Denn bevor Jenny und der Rest der Band die Bühne betreten, darf noch Micheal Reunion ran, ein Freund der Band, der mit lockeren Countrysongs schon etwas mehr Aufmerksamkeit auf sich zieht. Das Schocken hat sich inzwischen in ein Gewächshaus verwandelt, und während der Umbaupause für Rilo Kiley zieht es den Großteil der Zuhörer an die frische Luft. Ganz schnell sind aber alle wieder drinnen als die ersten Töne von „It’s a hit“ ertönen, mit dem die Band lautstark loslegt. Das Publikum wippt fröhlich mit, auch wenn die Bewegungsfreiheit im Gedränge sehr eingeschränkt ist. Drei Monate war die Band in Europa ununterbrochen auf Tour, doch von Müdigkeit oder Lustlosigkeit ist nichts zu spüren. Die Band genießt es spürbar, vor so einem begeisterungsfähigen Publikum ihr Abschlusskonzert zu spielen. Jenny Lewis lächelt die ganze Zeit vor sich hin, was sie noch entzückender macht, als sie eh schon ist. Im hellen Kleid und mit Krönchen im Haar steht sie auf der Bühne, zierlich und klein wirkt sie nicht älter als 17. Die Herren, die sich vorher so erwartungsvoll über sie unterhalten haben, sind wohl nicht enttäuscht. Jenny zieht die gesammelte Aufmerksamkeit auf sich, durch ihre fabelhafte Stimme, ihre Gesten, ihr Lächeln oder auch nur durch angedeutetes Augenrollen.
Bei „Paint’s peeling“ setzt sie sich ans Keyboard, und was ganz ruhig beginnt endet überraschend in einer Lärmorgie. Sowieso räumen Rilo Kiley ganz schnell mit Vorstellungen von glattem Indie-Pop auf, sie rocken ordentlich durchs Programm und vor allem Schlagzeuger Jason Boesel ist nach kürzester Zeit total durchgeschwitzt. Als Gitarrist Blake Sennett dann bei „Ripchord“ den Gesang übernimmt und nur von Jenny mit dem Tambourin begleitet wird, leert der Rest der Band alle auf der Bühne vorhandenen Getränke und lehnt sich entspannt zurück.
Die Pause dauert nicht lange, und bei „With my arms outstreched“ flippt das Publikum erst vollkommen aus, um sich dann am Schluss von Jenny nur mit Blicken und kleinen Winks wie ein Knabenchor dirigieren zu lassen. Erstaunlich textsicher sind die Zuhörer und der Anblick, wie sie an den Lippen der Sängerin hängen und mitträllern ist fast schon komisch. Weiter geht’s, „More adventurous“, „The execution of all things“, es gibt keine Pausen und die kurzen Ansagen beziehen sich vor allem auf die „fucking heat“. Blake erzählt, die Show am Vortag in Wien sei „horrible“ gewesen, und diese Letzte wolle man jetzt zu einer guten machen. Kaum ausgesprochen legt die Band mit „Portions for Foxes“ los, und es ist schon erstaunlich, wie charmant und freundlich Jenny Lewis auch die selbstkritischsten und negativsten Texte herüberbringt, bittersüß wirkt das alles und hat einen ganz besonderen Reiz.
Vielleicht wäre dieser Reiz noch größer gewesen, wenn nicht immer mit voller Kraft gespielt worden wäre. Kaum eine Atempause bleibt den Zuschauern, es geht immer vorwärts, und manchmal verpasst die Band etwas den Absprung - wie zum Beispiel beim eigentlich ruhigeren „The good that won’t come out“. Auch hier dreschen Schlagzeuger, Bassist und die beiden Gitarristen auf ihre Instrumente, hüpft und tanzt Jenny über die Bühne, und man ist sich nicht so ganz sicher, ob man beim dem Song jetzt eigentlich andächtig lauschen oder ihn zusammen mit der Band abfeiern soll. Die Spielfreude, die sie an den Tag legt, ist allerdings bemerkenswert, und allein das Zuschauen macht Spaß. Die Musiker scherzen untereinander, lachen, Instrumente werden getauscht und kleiner Verspieler mit einem Lächeln quittiert. Jeden Song macht die Band zum Ohrwurm, keine Sekunde wird nachgelassen, egal wie schweißgebadet alle sind und trotz der seltenen Ansagen kommuniziert die Band hervorragend mit dem Publikum.
Nach eineinviertel Stunden ist mit „Does he love you“ Schluss. Jenny singt zuckersüß „I wish you all go to hell“, macht natürlich keiner, obwohl sich Rilo Kiley lange bitten lassen. Dann kommen Blake und Jenny noch einmal auf die Bühne, und wunderschön bieten sie akustisch den Höhepunkt des Abends dar: „A better son/daughter“. Das Publikum wird noch einmal verzaubert und trällert am Schluss wieder in bester Knabenchormanier mit. In diesem Song zeigt sich, was gefehlt hat, um dieses Konzert zu einem hervorragenden zu machen: Die ruhigen Momente, das Nachdenkliche, das in den Rilo-Kiley-Songs angelegt ist. Egal. Die Band kommt auf die Bühne, feiert, winkt, verabschiedet sich, freut sich. Mit einem breiten Grinsen auf dem Gesicht und einem Pfeifen im Ohr verlasse ich den Club. Es war kein hervorragendes Konzert, aber ein Gutes. Vielleicht ein bisschen wie eine Seifenblase - bunt, schillernd und leider doch irgendwann zerplatzt.
Text: Verena Kurz